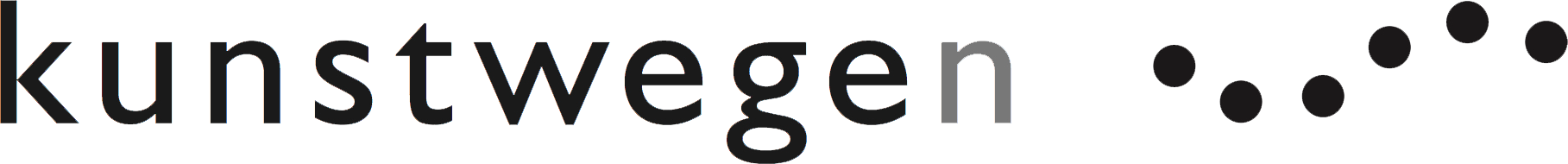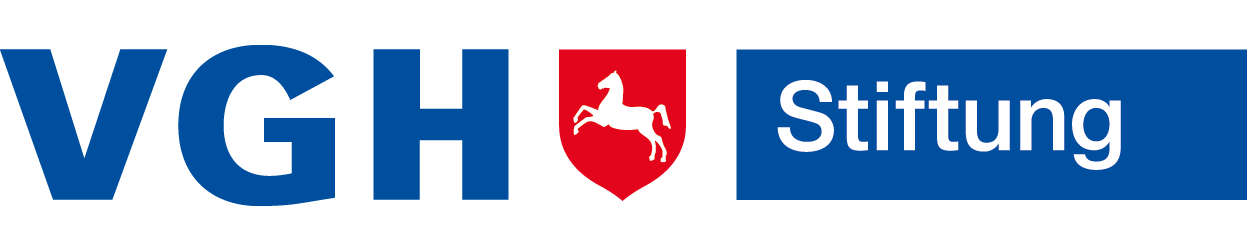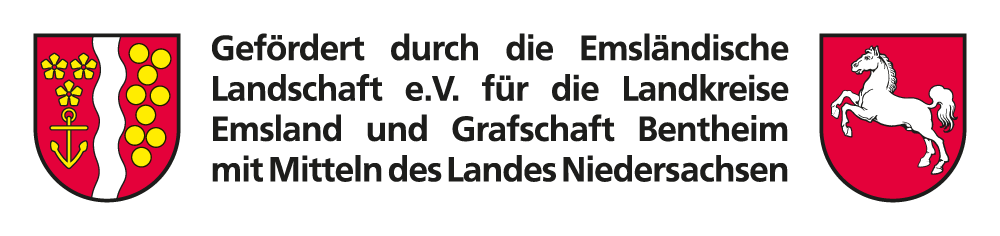Ausgehend von der Skulptur Ein Weg durch das Moor (1999) des Schweizer Künstlerduos Peter Fischli und David Weiss, die sich in direkter Nähe zum ehemaligen NS-Strafgefangenenlager Bathorn befindet, sind die Teilnehmenden der Summer School eingeladen, sich mit aktuellen Diskursen zur Erinnerungskultur und ihren möglichen künstlerischen Ausformungen auseinanderzusetzen. In Workshops, Performances, Lesungen und Diskussionen mit Künstler*Innen, Kurator*Innen und lokalen Akteur*Innen sowie in praktischen Arbeitseinsätzen zur Instandhaltung der Skulptur von Fischli & Weiss, soll der Frage „What’s art got to do with it?“ („Was hat Kunst damit zu tun?“) nachgegangen werden. Genauer gesagt, was hat Kunst mit Geschichtsaufarbeitung zu tun und welche Rolle kann, soll oder muss sie im Diskurs um kollektive Erinnerung spielen? In der Summer School wollen wir gemeinsam das Verhältnis zwischen den gesellschaftspolitischen und geschichtswissenschaftlichen Dimensionen der Erinnerungskultur und den kritischen Potenzialen künstlerischer Praxis ausloten.

Das Schweizer Künstlerduo Peter Fischli (*1952) und David Weiss (*1946–2012) widmet sich in ihren Arbeiten den Banalitäten des Alltags. Auf humorvolle und zugleich philosophische Weise decken die Künstler in kleinteiligen Installationen, Miniaturen und Kurzfilmen scheinbar nebensächliche Mechanismen unseres Zusammenlebens auf. Dabei bleibt kaum ein Material ungenutzt – von Würsten und anderen Essensresten bis hin zu Polyurethan, Gummi, Ton oder Holz. Durch die Verwendung dieser künstlerisch vergleichsweise wertlosen Rohstoffe und Techniken richten sie den Blick der Betrachter*Innen auf das hinlänglich Bekannte, um es dann ad absurdum zu führen. Seit dem Tod von David Weiss setzt Peter Fischli die Arbeit des Duos alleine fort. Der Einladung der Gastkuratoren Harald Szeeman und Zdenek Felix folgend, bauten Fischli & Weiss im Rahmen von „kunstwegen“ 1999 einen 1,2 km langen Steg aus Eichenholz durch das Waldgebiet hinter dem ehemaligen NS-Strafgefangenenlager Bathorn. Der schmale Rundweg läuft auf kein konkretes Ziel zu, zeichnet sich durch eine Vielzahl von Kurven sowie große Höhenunterschiede aus und ist an einigen Stellen lückenhaft. Durch die anspruchsvolle Gestaltung wird eine bewusste und konzentrierte Begehung notwendig. Auf halber Strecke lichtet sich der Wald kurzzeitig und gibt den Blick auf ein heute renaturiertes Torfabbaugebiet frei. Neben der wichtigen Rolle der Natur, auf die sich das Kunstwerk konsequent bezieht, indem ganz bewusst auf langlebige Metallstützen oder einen rutschfesten Belag verzichtet wurde, steht vor allem die Geschichte des Ortes und deren Reflexion im Mittelpunkt. Als stiller Begegnungsort bietet die Skulptur die Möglichkeit, die Geschichte der lokalen „Emslandlager“ und der dort internierten Gefangenen zu gedenken. Gleichzeitig lässt sie sich als bildhafter Verweis auf nicht-lineare und stets unvollständige Prozesse kollektiven Erinnerns lesen.
Das offene Museum „kunstwegen“ wurde im Jahr 2000 als grenzübergreifendes Projekt zwischen den Niederlanden und Deutschland eröffnet. Auf einer Strecke von über 180 Kilometern befinden sich derzeit mehr als 80 Skulpturen von internationalen Künstler*Innen. Aufgestellt entlang der Vechte, einem vom deutschen Münsterland bis zum niederländischen Ijsselmeer verlaufenden Fluss, verbinden die Skulpturen und Installationen die Grenzregionen. Die Kunstwerke gehen einen engen Dialog mit den örtlichen Gegebenheiten ein, indem sie Naturphänomene, regionale Eigenheiten und historische Ereignisse aufgreifen.

Zwischen 1933 und 1945 wurden im Gebiet des heutigen Emsland und der Grafschaft Bentheim insgesamt 15 sogenannte „Emslandlager“ von den Nationalsozialisten errichtet und betrieben. Sie waren Teil des groß angelegten Projekts der „inneren Kolonisierung“, das die als rückständig geltende Gegend zu einer wirtschaftlichen Vorzeigeregion machen und Platz für Siedler aus den Ostgebieten des Reiches schaffen sollte. In den Konzentrations-, Straf- und Kriegsgefangenenlagern wurden in den ersten Jahren vor allem politische Gefangene interniert und zur Arbeit im lokalen Torfabbaugebiet gezwungen. Sie stammten überwiegend aus dem sozialistisch bzw. kommunistisch geprägten Ruhrgebiet und wurden durch das von einigen Insassen selbst komponierte Lied „Die Moorsoldaten“ zu einem Sinnbild des internationalen antifaschistischen Widerstandes. Das Lager XIV Bathorn wurde 1938 errichtet und war ursprünglich für 1.000 Häftlinge ausgelegt. Nach Kriegsbeginn 1939 wurden hier, wie in den anderen „Emslandlagern“, vor allem Kriegsgefangene aus der Sowjetunion und Frankreich sowie dessen Kolonien interniert. Mit über 4.000 Häftlingen wurde der Standort Bathorn in dieser Zeit allerdings weit über Kapazität belegt. Schwerstarbeit, unzureichende Ernährung und mangelhafte hygienische Verhältnisse in den Baracken forderten zahllose Opfer. Das Lager wurde 1945 von kanadischen Soldaten befreit und zu einem Auffanglager für Geflüchtete und Vertriebene umgebaut.





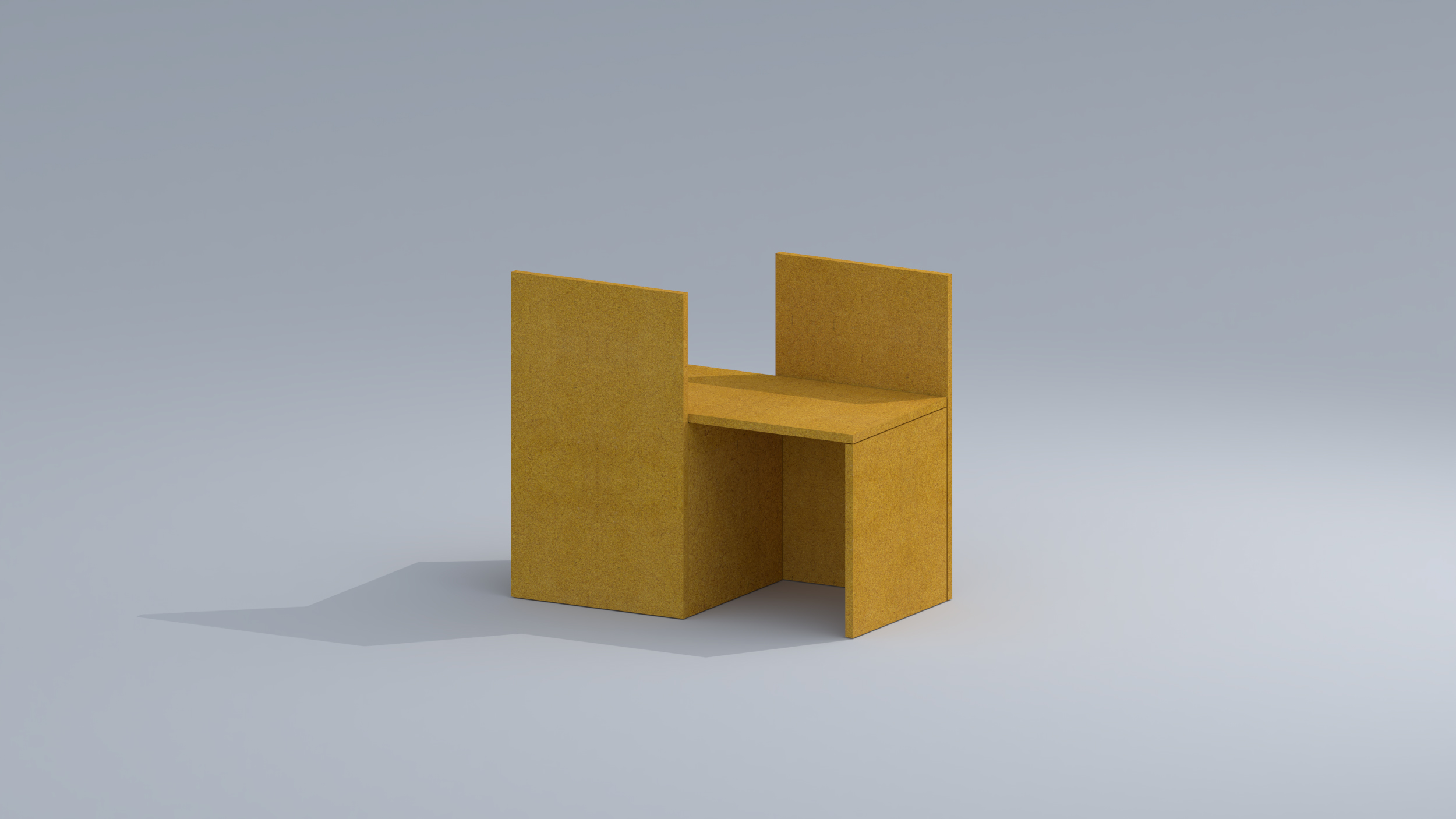
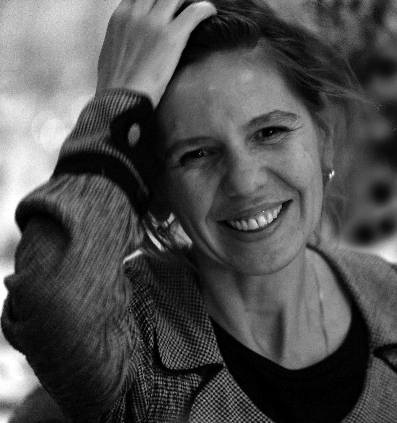


22.–28. August 2022
Dienstag 23. August 2022
Mittwoch 24. August 2022
Donnerstag 25. August 2022
Freitag 26. August 2022
Samstag 27. August 2022
Die Anmeldung erfolgt per Mail unter Angabe der persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, Email, Art der Teilnahme) an: info@whatsartgottodowithit.de
Anmeldefrist: 20.06.2022